| Dieser
Bericht ist parteilich. Die ihn geschrieben haben, waren vom
ersten Tage an mehr oder weniger aktiv am Aufbau der Sache
beteiligt, die jetzt „Club Ca ira" heißt. Sie berichten
deshalb nicht immer mit der für den professionellen
Journalisten angemessenen Distanz. Sie waren engagiert und sie
sind es noch. Trotzdem haben sie versucht, ein Stück
Wirklichkeit zu schildern und nicht ihre Wunschvorstellungen.
Die den „Club Ca ira" kennen, werden beurteilen müssen,
inwieweit ihnen dies gelungen ist.
Die Münstersche Straße in
Berlin-Wilmersdorf ist kurz, schmal und tot. Dörfliches
Kopfsteinpflaster entmutigt jeden Autofahrer, der sich vom
verkehrsreichen Fehrbelliner Platz oder von der geschäftigen
Ku-Damm-Gegend hierher verirrt haben könnte. Am einen Ende der
Straße baut die Evangelische Kirche, am anderen Ende haust
ein Grünwarenhändler in einer Holzbude. Eine zweite Holzbude
steht in der Mitte der Straße. Sie wurde von den Wasserwerken
errichtet und diente dem Jugendamt des Bezirkes Wilmersdorf als
provisorisches Freizeitheim. Im Frühjahr 1966 wurde hinter dem
Provisorium ein neues, ebenerdiges Jugendheim bezugsfertig.
Heimleiter Heiner Zenke zog um, und die Bude stand wieder leer.
Für genau eine Woche. Dann zogen neue Leute ein, mit Gitarren,
Plattenspieler, Farbtöpfen und zwei Klavieren. Berlins jüngste
Literaten und Folkloristen hatten sich erfolgreich nach einem
Aktionszentrum umgesehen. |

Ca ira - Flugschrift Winter 1967
|
Quellen: norwegisches Sommerlager und
amerikanische Folksong Revival
Der Boden für Berlins ersten
nicht-kommerziellen Literaten- und Folklore-Club war vorbereitet. Wie
immer bei solchen Sachen kamen mehrere Faktoren zusammen. Da waren zunächst
die Erfahrungen eines Teams, das in norwegischen Sommerlagern neue
Methoden kultureller Freizeitaktivitäten entwickelt hatte. Man hatte
dort einen Beat-Schuppen eingerichtet, der jeden Abend von tanz-
freudigen jungen Berlinern überschwemmt war. Dann war da noch der
Lagerfunk. Seine Redakteure, Ansager und Schallplatten-Jockeys fühlten
sich für möglicherweise vorhandene gehobenere kulturelle Ansprüche
zuständig. Um sie herum kristallisierte sich so etwas wie ein
politisch-literarischer Club mit Lesungen, Hörbildern, Diskussionen
und Susanne, einem schwarzhaarigen Meissner Porzellan-Mädchen mit
Guitarre und Joan-Baez-Stimme. In Erwartung eines Besuchs von Wolfgang
Neuß, der damals noch im „Domizil" am Berliner Lützow-Platz
seine „Jüngsten Gerüchte" verbreitete, nannten sie sich auch
„Domizil" (deutsche Jugend, Augustheft 1966, S. 371 ff.) und
lockten unter anderem Hans Magnus Enzens-berger für zwei Tage in ihren
Club. Nach Berlin zurückgekehrt, wurden die Domizil-Aktivisten von der
Frage verfolgt, ob man einen solchen Club für Jungarbeiter und Schüler
auch im Berliner Alltag etablieren könne.
Und dann war da die Folksong Revival an den amerikanischen Colleges und
Universitäten. In den fünfziger Jahren hatte in San Francisco das
Kingston Trio angefangen, alte anglo-amerikanische Volkslieder
aufzupolieren. Die Weavers folgten („Love is sweeter than wine",
„Lemmon tree"), und ein Sänger der Weavers, Pete Seeger, wurde
Anfang der sechziger Jahre zum Vorbild einer neuen Generation von
Protestsängern im Volkston. Diese Junge Generation der Joan Baez, Bob
Dylan, Tom Paxton, Phil Ochs und Peter LaFarge war am alten Volkslied
nicht um seiner selbst willen interessiert — gewissermaßen, weil es
zum nationalen Kulturerbe gehörte —, sondern weil man mit ihm etwas
machen konnte: Sie wollten mit ihren Liedern etwas aussagen und etwas
verändern. Sie fingen an, neue, zeitbezogene Texte auf die alten
Melodien zu machen, und sie fingen an, eigene Lieder im Volksliedton zu
erfinden. Der „topical folksong" entstand, und das alljährliche
Volksliedfest in der Hafenstadt Newport wurde ihr Kommunikationszentrum.
Hier sang die Baez zum erstenmal vor einem tausendköpfigen Publikum,
und hier wurde Bob Dylan zum erstenmal ausgebuht, als er — nach
Meinung seiner Anhänger — den Folksong verriet und zum Folkrock überlief.
Zwei Themen waren es vor allem, die in den neuen Liedern der Jungen
Protestierer eine Rolle spielten: der Kampf der amerikanischen Neger um
ihre politisch-gesellschaftliche Gleichberechtigung (civil rights
movement) und der „schmutzige Krieg in Vietnam". An dieser Stelle
verband sich die musikalische Aktivität der Protestsänger mit der
politischen Aktivität der amerikanischen „neuen Linken", ihrem
Versuch, eine Alternative zum etablierten Zweiparteien-System auf die
Beine zu stellen. Wo immer in den letzten fünf Jahren in Amerika öffentlich
protestiert wurde, wurde auch öffentlich gesungen. Bei den Bus-Fahrten
der Neger in den integrationsfeindlichen Süden (freedom riders), bei
den Protestmärschen nach Montgomery, Alabama (freedom marches), bei den
Sitzstreiks der Studenten gegen die Kriegspolitik Präsident Johnsons (sit-ins),
bei den Protestvorlesungen amerikanischer Professoren mit dem Ziel des
Truppenrückzugs aus Vietnam (teach-ins) und bei dem Versuch, durch
Sitzstreiks vor dem Umschlaghafen der amerikanischen Armee in Port
Chicago bei San Francisco das Verladen von Napalm-Bomben zu unterbinden.
Einige dieser neuen Lieder sind inzwischen weltbekannte Schlager
geworden, wie Pete Seegers „Where have all the flowers gone", Bob
Dylans „How many times", Melvina Reynolds „What have they done
to the rain". Die härteren Protestlieder aber, und sie zählen
nach hunderten, haben eine geringere Chance, in Europa populär zu
werden. Keine amerikanische Rundfunkstation sendet Tom Paxtons „We
heip save Vietnam from Vietnamese", und Phil Ochs („We are the
cops of the worid") ist aus den gleichen Gründen in Europa fast
unbekannt.
Informeller Start: man fing einfach
an
So, wie in diesem Frühjahr ein paar spätere
Ca-ira-Clubgründer mit Erinnerungen an das norwegische
Sommerlager-Domizil durch Berlin liefen, so liefen andere mit einem
Stapel amerikanischer Schallplatten durch Berliner Jugendheime und erzählten
ihren jugendlichen Zuhörern mit musikalischen Beispielen die Geschichte
der politischen Wiederbelebung des amerikanischen Volksliedes. Dabei
entdeckten sie, daß es offensichtlich eine Menge junger Berliner gab,
die ihren Bob Dylan auf dem Plattenteller und eine Gitarre im Schrank
liegen hatten. Und sie entdeckten in Berliner Jugendheimen einige aktive
Folklore-Gruppen, die auf eine eigene Plattform für ihre
musikalisch-politische Aktivität warteten.
Diese drei Gruppierungen: die Leute aus dem Norwegen-Camp, die
Amerika-Fahrer und die Berliner Folkloristen beschlossen, sich
gegenseitig — und dazu einige Bekannte — zu einer privaten „Hootenanny"
(das ist so etwas wie das folkloristische Gegenstück zur „jam session")
einzuladen. Es kamen 70 Gäste. Sie baten einen Sänger, ein paar Lieder
zu singen. Es sangen 30. Damit war das Eis gebrochen. Ermutigt durch
einen verständnisvollen Jugend-Stadtrat, der seine gerade leerstehende
Baracke mietfrei zur Verfügung stellte, zogen die drei informellen
Gruppierungen am l. April 1966 in die Münstersche Straße. Alle waren
zwischen 20 und 35 Jahre alt und von Beruf Jugendpfleger, Facharbeiter,
Studenten, Journalisten, Bibliothekarin, Buchhalterin und
Hochschullehrer.
Mit den ersten 100 Mark, die sie zusammenlegten, kauften sie Farbe. Mit
den 1000 Mark, die sie von ihren Bekannten auf Grund eines Bettelbriefes
bekamen — später folgten noch einmal 1000 Mark — kauften sie wieder
Farbe, Lampenschirme, Gläser, Elektromaterial und Material für
Selbstbautische. In den Möbellagern der Berliner Wohlfahrtsämter
fanden sie aus dem Nachlaß verstorbener Wohlfahrtsempfänger wunderschöne
altmodische Stühle, Jugendstilsofas und Gipsbüsten. Der Leiter eines
Gewerkschaftsjugendzentrums stiftete eine riesige Bar, die einer
amerikanischen Filmfirma einen Tag lang als Dekorationsstück für eine
Berlin-Schnulze gedient hatte. Alte Spiegel tauchten auf, Geschirr und
ein Grammophon.
Und junge Leute, die mithelfen wollten. Obwohl es in keiner Zeitung
gestanden haue, obwohl keine Abendschau davon berichtet hatte, kamen
jeden Nachmittag neue, unbekannte Mitarbeiter, sagten „Guten Tag"
oder auch gar nichts und sahen sich nach Pinsel, Säge und Arbeit um.
Nach 14 Tagen klappte es so gut, daß ausführliche, an einen überdimensionalen
Gründerzeit-Spiegel geklebte Arbeitsanleitungen genügten, um 30
freiwillige Helfer zu geordneter Renovierungsarbeit anzuregen. Man
kannte sich zu Anfang kaum. Man wußte nur: „In der Münsterschen Straße
sollen sie einen Folklore-Schuppen aufziehen". Das genügte
offenbar.
Nach ziemlich genau vier Wochen war das stilvolle — manche sagen: zu
stilvolle — Folklore-Lokal mit einem nur sehr geringen Anteil öffentlicher
Mittel aufgezogen. Der durch das Versetzen einer Wand vergrößerte
Hauptraum faßt 100 Personen in Sitzgruppen zu zweit, viert und sechst
unter 15-Watt-Korbhängelampen mit schmalen Tischen für Aschenbecher,
Coca, Bier oder Wein und schwarzweiß lackierten Altbaustühlen aus
der Großmutterzeit, dazu eine geräumige Bar für etwa 20 Gäste, ein
Podium mit Klavier, Übertragungsanlage und Scheinwerfern in alten
Konservenbüchsen.
Der Vorraum wird von alten Spiegeln und einem Schwarzen Brett
beherrscht, auf dem man sich über politische, literarische und
musikalische Veranstaltungen informieren kann, aber auch darüber, wer
eine Gitarre kaufen möchte und welche Folkloregruppe noch eine zweite
Stimme braucht — oder ein Mädchen.
Vom Vorraum führen fünf Türen in eine winzige Teeküche, ein ebenso
winziges Büro, einen Vorratsraum, einen workshop, wohin man sich zum
Reden oder Singen zurückziehen kann, wenn es im Hauptraum zu turbulent
zugeht, und einen Übungsraum für die Karate-Gruppe, die noch aus alten
Jugendheimzeiten Hausrecht besitzt.
Anfang Mai wurde der „Folklore-Schuppen" mit einer Party aller
Mitarbeiter eröffnet. Diese Party verschaffte einen ersten Überblick,
wer nun tatsächlich mitgearbeitet hatte. Es erschienen 90 junge Leute
zum überdimensionalen Kalten Büffet — dazu noch viele Neue, die auf
einen anderen Tag vertröstet werden mußten. Damit war der Club zum
Leben erwacht. Und er hatte auch einen Namen bekommen — in einer Kampf
abstimmung des „inneren Kreises" war mit Mehrheit für „Ca
ira" entschieden worden: weil das mal nicht englisch, sondern französisch
sei und weil das eines der ersten bedeutenden politischen Protestlieder
gewesen sei, ein Gassenhauer, der im Jahre 1790 mit neuem Text („Die
Aristokraten an die Laterne") vom Schlager zur Nationalhymne der l.
Französischen Republik avanciert sei.
Wenn man von „Kampfabstimmung des inneren Kreises" spricht, dann
muß man natürlich etwas über die nicht sehr einfach durchschaubare
personelle Struktur des Clubs sagen.
Zu Beginn der Renovierungsarbeiten fühlten sich die ursprünglichen
Aktivisten verantwortlich für den Club. Im Laufe der Arbeiten stießen
etwa zehn Jugendliche dazu, die mit solcher Regelmäßigkeit spezielle
Verantwortung übernahmen, daß sie bei der Eröffnung des Clubs einfach
dazu gehörten. In den ersten Monaten der Clubarbeit kamen noch einmal
ungefähr zehn Jugendliche dazu, die regelmäßig sangen, regelmäßig
hinter der Bar standen oder sich auf andere Weise unentbehrlich machten.
Diese ständig größer werdende Gruppe von Aktiven saß in wechselnder
Zusammensetzung einmal in der Woche um eine umfangreiche Tagesordnung
und entschied organisatorische, inhaltliche und finanzielle Fragen.
Die organisatorische Struktur des Clubs war relativ einfach. Der
„innere Kreis" wählte zwei gleichberechtigte Vorsitzende und
eine Kassenführerin und verpflichtete sich dem Jugendamt gegenüber
zu strikter Einhaltung der üblichen Jugendpflege- und
Jugendschutzbestimmungen. Getränke bezieht man über den Berliner
Jugendclub e.V., der die entsprechende Lizenz besitzt, der
Landesrechnungshof
überprüft das Geschäftsgebaren, und das „Bedienungspersonal"
unterzieht sich der notwendigen gesundheitsamtlichen
Routineuntersuchung.
Die finanziellen Probleme des Clubs waren bisher ebenfalls recht
einfach. Mit dem privaten Spendenkapital von 2000 DM konnte man zunächst
an die Arbeit gehen. Die vielen freiwilligen Mitarbeiter, vor allem die
jungen Elektriker, Polsterer, Installateure, Tischler und Maler
verbilligten die Renovierung enorm. Gardinen wurden selbst genäht,
Lampen preiswert angefertigt, Stühle eigenhändig bezogen. Die
jeweilige Abendeinnahme (durchschnittlich zwischen 100 und 200 DM bei mäßigen
Preisen und freiem Eintritt) wird regelmäßig auf das Club-Konto überwiesen,
und trotz Sommerflaute konnten in den ersten vier Monaten Übertragungsanlage,
Heißwasserspeicher und Geschirr aus eigenen Mitteln angeschafft
werden. Das war nur durch einen strikten Grundsatz möglich, der bisher
nicht durchbrochen wurde: Kein Mitarbeiter — ganz gleich, ob hinter
der Bar oder auf dem Podium — nimmt für seine Arbeitsleistung vom
Club Geld. Nach langer Diskussion wurde dieser Grundsatz wenigstens so
weit modifiziert, daß Mitarbeitern, deren Taschengeld nicht für
Fahrgeld oder Taxi reicht, die reinen Fahrtkosten ersetzt werden.
Informelles Programm: zwischen
Improvisation und Planung
Von Anfang an war der Club an jedem
Donnerstag, Freitag und Sonnabend von 18.00 bis 24.00 Uhr geöffnet.
Jeweils ein oder zwei Mitarbeiter bereiteten für die Zeit zwischen
20.30 und 21.30 Uhr eine Art Programm vor: donnerstags etwas
Literarisches, freitags internationale Folklore und sonnabends
Interviews mit Zeitgenossen („Who ist who") oder Diskussionen
(„What ist what"). „Eine Art Programm" ist ein weitgefaßter
Begriff. Programm im Sinne des Clubs kann darin bestehen, daß der
Programmgestalter des jeweiligen Abends gegen 20.15 Uhr ans Mikro tritt,
die Gäste begrüßt und einen ihm bekannten anwesenden Banjospieler
bittet, doch mal eben nach oben zu kommen. Programm kann aber auch darin
bestehen, daß der Programmgestalter mit einigen Bekannten eine vom
ersten bis zum letzten Satz vorgeplante szenische Lesung auf die Beine
stellt (etwa die Trujillo-Reportage von H. Magnus Enzensberger, „Junge
Literatur in der DDR" oder „Gruselgeschichten" von Poe,
Capote, Kafka oder „Dichter und Vagabunden" mit Villon,
Rimbaud, Gorki und Kerouac).
Der Freitag ist gewöhnlich, vom Programm her gesehen, der informellste
Tag. Alle Versuche, internationale Folklore unter bestimmte Themen zu
stellen, scheiterten, weil immer wieder zahlreiche bekannte und
unbekannte Sängerinnen und Sänger darauf warten, das Mikrophon
benutzen zu können. Im letzten Monat allein beteiligten sich etwa 40
Folkloristen an der freitaglichen „Hootenanny", die meist in eine
Art folkloristische „jam session" einmündet mit Beteiligung
aller anwesenden Sängerinnen und Sänger und des animierten Publikums.
Obwohl der topical folksong besonders geschätzt wird, sind immer auch
traditionelle Volkslieder aus aller Welt vertreten, besonders natürlich
aus England, Amerika, Irland, Schottland, Israel, Rußland und vom
Balkan. Von Zeit zu Zeit finden sogenannte „Protestivals" statt,
auf denen die Sänger politische Eigenproduktionen vorstellen.
Bevorzugte Themen: Vietnamkrieg, Bildungsnotstand, Starfighter,
Wohlstandsbürger, Generationenkonflikt.
Der Sonnabend ist thematisch am offensten. Das Wochenendprogramm reicht
vom Intensivinterview eines Volkssängers, eines Politikers oder eines
Journalisten über eine Podiumsdiskussion über Bildungswerbung bis zu
Fragen der Geschlechtserziehung.
Nachdem das Programm mit dieser Grundstruktur einen Monat lang gelaufen
und dank eines ungewöhnlich rührigen clubeigenen Pressechefs von der
Berliner Publizistik wohlwollend und ausführlich beachtet worden war,
wurde es auf Initiative des Publikums erweitert. Ein Student stellte
grafische Arbeiten aus, ein Oberschüler hängte surrealistische Ölbilder
in die Clubräume. Unbekannte Jung-Autoren lasen aus eigenen Werken,
spanische Republikaner sangen Freiheitslieder, katalanische Volkstänzer
tanzten auf dem sandigen Boden vor der Baracke. Studenten organisierten
kleine workshops, um den Autoren deutscher Protestlieder zu helfen, ihre
Texte zielgenauer zu fassen. Darüber hinaus fanden neben manchen
heimischen auch ausländische Künstler den Weg in den Club, so zum
Beispiel die Akteure der Prager „Laterna Magica", des „Living
Theatre's" und andere mehr. Eine eigene Folklore-Zeitschrift (PINX)
erscheint in diesem Monat mit vierter rotaprint-gedruckter Nummer. Die
club-eigene Ca-ira-Presse druckt auf Anfrage deutsche und amerikanische
Lieder-Texte.
Obwohl sich also der Personenkreis der Programmgestalter laufend verändert
und erweitert, wurden einige Grundsätze der Programmgestaltung bisher
ziemlich genau eingehalten:
(l) Das Abendprogramm sollte auf die Zeit zwischen 20.30 und 21.30 Uhr
beschränkt werden. (2) Das Programm sollte so offen gehalten werden, daß
die anwesenden Gäste zur Mitarbeit ermutigt werden. (3) Jedes
Programm sollte einen Bezug zu aktuellen gesellschaftlichen Fragen
haben. (4) Das Programm sollte vor allem auf die Altersgruppe der unter
20jährigen und die Gruppen der Jungarbeiter, Angestellten und Schüler
zugeschnitten werden.
Nach jedem „Programm" ist die Bühne frei für Gäste.
Reibungslos — aber oftmals durch Zwischenrufe und Diskussionen
unterbrochen — wechseln Gedichte, Volkslieder, Protestsongs und kurze
Reden. Je später es wird, um so mehr lockert sich die Atmosphäre, und
kurz vor Mitternacht sitzen Sänger, Sprecher und Gäste dichtgedrängt
auf dem Fußboden um das Podium, und es fällt schwer, eine stabile
Grenze zwischen Akteuren und Zuhörern zu ziehen.
Natürlich ist nicht ein Abend wie der andere. Manchmal wirkt das
Publikum recht zähflüssig und matt, manchmal sind die auf der Bühne
Agierenden nicht in der rechten Stimmung, manchmal ist das Programm zu
lang angelegt. Diskussionen zwischen Bühne und Publikum kommen nur dann
auf, wenn das Thema wirklich jedermann betrifft, wie etwa ein Abend über
Sinn und Unsinn des 17. Juni als Nationalfeiertag oder eine
Podiumsdiskussion „Protest-Song — nötig oder nicht", von der
ein prominentes Club-Mitglied meinte: „Unsere Nachwuchssänger machen
seitdem bessere Lieder; außerdem war die Beteiligung durch die Zuhörer
enorm."
Natürlich ist nicht jedes Abendprogramm ein Erfolg. Über ein happening
zum „Tag des Zorns" (dem Jahrestag der französischen Revolution)
schrieb ein Club-Mitglied in sein Tagebuch: „Es war Käse. Alle guten
Gags sind im Gebrüll sehr lustiger Leute, die etwas falsch verstanden
hatten, untergegangen. Da half nicht mal Klavierverbrennen oder Stricken
auf der Bühne. Schade. Es wurde richtig Sylvester."
Ein ernsthaftes und ungelöstes Problem sind die — jedem
Jugendheimleiter vertrauten — „Entwendungen" beweglicher
Gegenstände. Einmal war es ein Mikrophon, einmal waren es
Langspielplatten, ein drittes Mal: eine wohlassortierte Zusammenstellung
von Bier, Limonade, Martini, Wein, Erdnüssen und Schokolade. Nach
solchen Schicksalsschlägen laufen die Mitarbeiter recht niedergedrückt
durch die Baracke, aber außer sozialpsychologischen Erklärungsversuchen
ist bisher niemandem eine Lösung eingefallen.
Ein weiteres ungelöstes Problem ist die Frage des Mitglieder-Status. Im
Augenblick hat der Club 24 Mitglieder. Das sind neben den drei „ursprünglichen
Gründer-Gruppierungen" und dem Wilmersdorfer Jugend-Stadtrat die
jungen Leute, die sich bei der Organisation und beim Programmgestalten
unentbehrlich gemacht haben. Viele Gäste aus dem Stammpublikum scheinen
aber den brennenden Wunsch zu haben, ebenfalls Club-Mitglied zu werden.
Der „innere Kreis" ist damit grundsätzlich einverstanden. Aber
wer soll die rote Mitgliedskarte bekommen? Jeder, der dazu Lust hat?
Jeder, der einen monatlichen Mitgliedsbeitrag bezahlt oder einen Teil
seiner Arbeitskraft in den Dienst des Clubs stellt?
Diese Streitfrage ist im Augenblick noch nicht entschieden. Aber die
eigengesetz-liche Dynamik der Entwicklung von Ca ira hat inzwischen
Tatsachen geschaffen, die bei jeder künftigen Entscheidung berücksichtigt
werden müssen. Diese Tatsachen hängen damit zusammen, daß während
des Hochsommers ein Teil der Gründungsmitglieder und der Stamm-Sänger
nicht in Berlin war. Das entstehende Vakuum wurde von neuen Sängern,
Sprechern, Organisatoren und Programmgestaltern geräuschlos und
durchaus im Sinne der ungeschriebenen Club-Idee ausgefüllt. Der
Kommentar eines aktiven Mitgliedes: „Viel von dem konnte verwirklicht
werden, was wir als unser ungeschriebenes Manifest bezeichnen könnten.
Dutzende von Jugendlichen helfen bei den Interviews, an der Bar und beim
Programm. ... Es macht von Woche zu Woche mehr Spaß. Ca ira ist
augenblicklich wirklich ein Club von Jugendlichen für Jugendliche.
Morgen ist große Sitzung:
viele neue Leute wollen sich bewerben."
Informelle Struktur: wie lange kann
man sie halten?
Wenn Journalisten in den Club kommen und
fragen, „wer hier nun eigentlich verantwortlich ist", dann
sehen sich die Mitarbeiter erstaunt an. Sie wissen es nicht. Es scheint
keine oder vielleicht noch keine allen bekannte Hierarchie der
Verantwortlichkeit zu geben. Anders gesagt: diese Hierarchie verschiebt
sich von Monat zu Monat und von Aufgabenbereich zu Aufgabenbereich.
Jeder macht, was ihm Spaß macht, und im Augenblick scheint es noch genügend
Aufgaben zu geben, die Spaß machen, und genügend potentielle
Mitarbeiter, denen sie Spaß machen.
Auf die Dauer zeigt sich, daß die ad-hoc-Initiative dieser Jugendlichen
der Koordinierung einiger weniger bedarf. Durch den offenkundigen, möglicherweise
notwendigen permanenten Einsatz einiger weniger beginnt sich die
informelle Struktur des Clubs zu verfestigen, und es entstehen nicht
vorhergesehene, die spontane Aktivität manchmal hemmende Autoritätsbeziehungen.
Der Club hat an den drei Abenden einer Woche zusammen ungefähr 500 Gäste.
Ein Teil von ihnen fühlt sich an einem nicht genau zu definierenden
Punkt zusammengehörend. Dabei denken die Stammbesucher weder
gleichgerichtet noch tragen sie die gleiche Kleidung noch mögen sie die
gleichen Lieder. Aber sie haben ein informelles Informationssystem
entwickelt. Keiner weiß, wie sie das machen, aber wenn Joan Baez nach
Berlin kommt, und niemand sollte es eigentlich wissen können, weil es
in keiner Zeitung gestanden hat und nicht an die Litfaßsäulen geklebt
wurde, dann wissen sie Bescheid. Wenn an der Freien Universität eine
studentische Protestversammlung stattfindet, dann scheinen ihre
Telefondrähte zu glühen. Wenn einer dem anderen sagt: „Am
soundsovielten ist dort und dort das und das los", dann sind sie an
diesem Tage und an diesem Orte anwesend und sehen sich gegenseitig
wissend an.
Das scheint man auch außerhalb des Clubs zu merken. Wenn die
evangelischen Studenten eine Veranstaltung mit Protestsängern planen,
dann wenden sie sich nicht an einzelne Sänger, sondern an den Club. Und
im Club wird dann abgesprochen, wer geht und was er singt. Die Frage
ist, wie lange der Club diese vergleichsweise offene, informelle
Struktur durchhalten kann. Mit dem ersten Erfolg kommen neue Aufgaben:
ein Berliner Sender plant ein großes Jamboree, das Landesjugendamt eine
ebenso große Hootenanny. Schallplattenfirmen interessieren sich für
Live-Mitschnitte. Kommerzielle Fragen tauchen auf. Die Besucherzahl wächst
nach der Sommerpause ständig. Die liebe alte Baracke platzt aus den Nähten.
Viele Schüler müssen im neuen Schuljahr vorsichtiger mit ihrer
Freizeit umgehen. Jeder dieser Sätze enthält eine Fülle von Problemen
für den Club und seine noch immer informelle Struktur. Aber, wie auch
immer sie bewältigt werden:
wenn die Gründung von Ca ira ein interessantes Experiment war, so wird
seine Fortführung nicht minder aufschlußreiche Erfahrungen liefern.
|
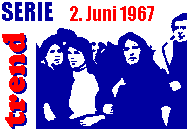
![]()